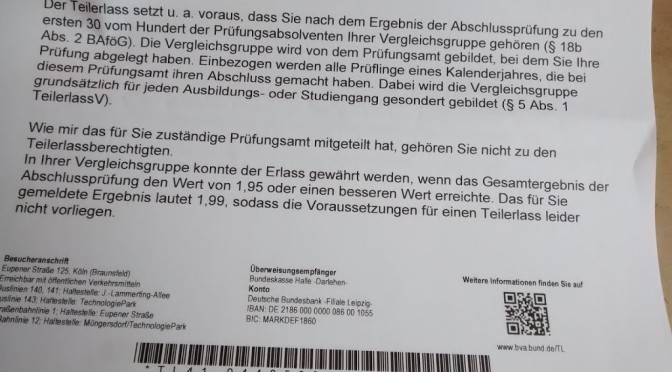Die Klinkenbuchse an meiner E-Gitarre war schon eine ganze Weile locker. Aber nach einem Versuch, das Ganze mit ein paar Zangendrehungen wieder zu fixieren, sind nun offenbar irgendwelche Kabel locker oder abgerissen.
Im Musikladen hieß es dann beim brummenden Anspielen einiger Amps, man müsse da mal die „Masse“ wieder anlöten. – Oha. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. (Dunkle Wolken ziehen auf.) – Weit weg von Zuhause, wo es immer jemanden gab, der wusste, wie man mit Kabeln und Strom umgehen muss, um nicht gegrillt in der Ecke zu liegen. Beim Bund hieß es schließlich auch immer Strom mache klein, schwarz und hässlich.
Schauen wir erstmal, ob wir das vielleicht auch so hinkriegen. Von Vorne sieht’s noch ganz gut aus:
Und hinten? – Ah, Schrauben! Schrauben sind der Hinweis für Verbraucher: Hier kannst du mal reinschauen und weißt danach ganz genau, warum du das Teil bei uns eingekauft und nicht selbst gebaut hast. – Nämlich weil du keine Ahnung hast! Und jetzt schraub das Ding einfach wieder zu und wir reden nicht weiter darüber.

Nunja… äääähhh… Wie war das noch gleich mit dem Schwein und dem Uhrwerk? Also: Unten Links ist die Buchse, in die das Gitarrenkabel von der anderen Seite reingesteckt wird. Da sieht man dann auch schon den „abben Draht“ (blau). Und ein weiteres Kabel fehlt dort auch, um da so alles stromkreislaufmäßig korrekt zu gestalten. Von nahem sieht man auch zwei Lötpunkte an dieser Buchse, an denen die Kabel vorher festgemacht gewesen sein mussten. Dann sind da noch diese vier hellen Metalldinger, die das Gegenstück zu den Drehknöpfen für Lautstärke und „Tone“ auf der Vorderseite sind. Oben rechts ist der Drei-Wege-Kippschalter, von dem das blaue Kabel kommt. Keine Ahnung, wie das funktioniert und warum das Ganze so ist wie es ist. Es muss jetzt aber irgendwie repariert werden!
Was macht die Generation Y in so einem Fall? – Googlen! Wikipedia-Artikel und Fotos haben mich erst nicht so recht weiter gebracht. So tief wollte ich hier eigentlich nicht ins Thema einsteigen. Es hat dann noch etwas gedauert, bis ich direkt nach dem Modell gesucht und ein passendes Diagramm gefunden habe:
Yeah, Baby! Sieht gut aus! Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wo welches Kabel hin muss und dass auch definitiv eins fehlt. Es scheint beim Aufmachen irgendwie verloren gegangen zu sein. Wahrscheinlich war das dieses ominöse „Masse“-Kabel, von dem der Typ im Musikladen sprach.
Nach einem kurzen Gedankenspiel, ob und wie man das Problem mit Klebeband lösen könnte, dämmerte es mir: Es muss gelötet werden!
Was braucht man eigentlich zum Löten? – Eine kurze Recherche und Erinnerungen an Papas Garage und Arbeitszimmer ergeben: Zumindest mal Lötkolben, Lötzinn und „Litze“ (= ummantelter Draht).
Ich war mir schon darüber im Klaren, dass man diese Utensilien wahrscheinlich schnell und unkompliziert im Baumarkt kriegt, hab dann aber aus Gewohnheit und Faulheit doch zwischendurch schnell online bestellt und das auch schon bereut. – Drei unterschiedliche Lieferanten, die alle natürlich noch nie was von Express-Lieferungen gehört haben. Ein Baumarktbesuch hätte hier deutlich schneller zum Erfolg geführt und wär volkswirtschaftlich und ökologisch sicherlich auch effizienter gewesen. Nunja. Lehrgeld. Auf ein dekadentes Lötzinnabsauggerät habe ich aber erstmal verzichtet.
Puh, also los. Der Lötkolben kann 200 bis 450 Grad. Bei 375 klappt es ganz gut. Das Zinn schmilzt und mit einer Zange krieg ich auch den Draht aus dem Kabel raus. Leider ist das Ding seeeehr dünn:
Da ist also ein blauer Mantel, die spinnenartigen Drähte sind wohl als Abschirmung (/ Masse?) gedacht. Dann kommt noch ein weißer Mantel mit dem Draht, den ich eigentlich für die Signalübertragung bauche.
An dem Ende ist aber auch noch verdammt viel Zinn dran. Mal heiß machen… Mh,.. ja, so geht’s. Ok. Gut. Weiter so. Und… Scheiße! Jetzt ist da so ein flüssiger Zinntropfen runtergefallen. Ok. Kurz pusten und das getrocknete Teil wieder raus da. Puh! Geschafft.
An der Anschlussstelle an der Buchse ist auch noch ziemlich viel Zinn. Das ist doch bestimmt nicht gut. Mal heiß machen und gucken, ob’s irgendwie weggeht. – Tut’s nich. Grrrrr. Jetzt bräuchte man irgendwas wie ein… ein Ding zum… ein Ding, mit dem man Lötzinn irgendwie… absaugen könnte. Hab ich jetzt aber grad nicht da. Also einfach „abschütteln“, wie die Jungs von Cubeaudio es nennen. (Danke auch für den doppeldeutigen Titel!)
Und dann: Was lange währt, wird endlich… naja… hinnehmbar:
(Man beachte das durch die zahlreichen fehlgeschlagenen Versuche stark verkürzte blaue Kabel.)
Zugeschraubt. Fertig. Irgendwann wackelt’s bestimmt wieder irgendwo auseinander, aber bis jetzt geht alles problemlos. Die rechte (graue) Hälfte meiner neuen Super-Litze hat einen vielfachen Aderquerschnitt, was aber durch die geringen Spannungen/Stromstärken hier wohl nicht so problematisch ist.
Alles funzt. Welt gerettet. I have soldered! Der Goldene Lötkolben 2015 geht an mich!
Keep on rockin‘ the free world!